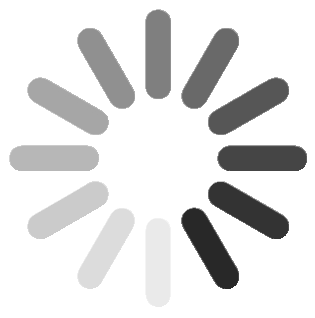Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen einen optimalen Service zu bieten.
083/2014 - Stadtrat
Beratungsfolge ...
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Bau- und Umweltausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
03.11.2014
|
|||
|
|
|
Stadtrat Wernigerode
|
Entscheidung
|
|
|
|
06.11.2014
|
ungeändert beschlossen (083/2017)
|
Finanzielle Auswirkungen ...
Finanzielle Auswirkungen: ja
Aufwendungen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
€ | € | € | € | € | € | € | |
Gesamtprojekt | 28.000,00 | 33.300,00 | 24.400,00 | 20.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 118.300,00 |
davon Fördermittel | 20.300,00 | 15.500,00 | 10.500,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 62.100,00 |
davon Eigenmittel | 7.700,00 | 17.800,00 | 13.700,00 | 12.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 56.200,00 |
davon Personalkosten (bestehendes Personal) | 7.700,00 | 7.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 27.200,00 |
tatsächliche Auswirkungen auf den Haushalt | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
Produkt: 3.6.6.02
Die tatsächlichen Eigenmittel (29.000,00 €) sind Teil der laufenden Kosten im Sachgebiet Grünlagen.
Anlage/n ...
Begründung:
Das Projekt „Stadtgrün – Artenreich und Vielfältig“ wird im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie das Bundesamt für Naturschutz gefördert. Projektbeginn ist voraussichtlich der 1. April 2015. Die Projektlaufzeit beträgt fünfeinhalb Jahre. Im Rahmen des Projekts sollen mit Hilfe eines Labels, einer Kampagne sowie praxisorientierter Handreichungen bundesweit ökologische Standards für die Bewirtschaftung öffentlicher Grünflächen geschaffen werden.
Mit dem Label werden Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung öffentlicher Grünflächen sowie entsprechende Planungs- und Umsetzungsprozesse ausgezeichnet. Voraussetzung für den Erhalt des Labels ist zudem eine kommunale Grünflächenstrategie mit Maßnahmenplan. Im Rahmen der Kampagne wird innerhalb der Bürgerschaft für eine größere Akzeptanz naturnah gestalteter Grünflächen geworben und das Engagement der am Labeling-Verfahren teilnehmenden Kommunen bundesweit sichtbar gemacht. Um die Praxistauglichkeit des Labels sowie der Kampagne sicher zu stellen, werden zehn ausgewählte Pilotkommunen in deren Entwicklung einbezogen. Label und Kampagne werden anschließend in den Pilotkommunen erprobt und entsprechend weiterentwickelt. Hierzu führt jede Pilotkommune ein konkretes Grünflächenprojekt durch. Im Gegenzug erhalten die zehn Pilotkommunen eine finanzielle Förderung für die Umsetzung der im Zusammenhang mit dem Label stehenden Maßnahmen.
Die Stadt Wernigerode hat sich mit dem Projekt „Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Mühlgräben sowie deren naturnahe Gestaltung“ erfolgreich als Pilotkommune beworben.
Damit kann die Stadt Wernigerode in einem Zeitraum von fünfeinhalb Jahren auf Fördermittel in Höhe von bis zu 62.100 € zurückgreifen. Der Eigenanteil beträgt 48 Prozent und kann in Höhe von bis zu 27.200 € durch die im Rahmen des Projektes anfallenden Personal- und Sachgemeinkosten sowie in Höhe von 29.000 € in Form der Investitionen für das Grünflächenprojekt geleistet werden. Damit ergibt sich ein Gesamtvolumen von bis zu 118.300 €. Leistungen wie die Bestandserfassung öffentlicher Grünflächen, die Konzeptionierung der Grünflächenstrategie inklusive Maßnahmenplan sowie das Monitoring der Grünflächenstrategie können zu 100 Prozent über das Projekt finanziert werden.
Die Beteiligung am Projekt wird zu gegebener Zeit einen weiteren Beschluss dieses Gremiums erfordern, mit dem die politische Unterstützung der im Rahmen des Projekts zu erarbeitenden Grünflächenstrategie inklusive Maßnahmenplan sichergestellt wird. Dieser Beschluss muss frühsten eineinhalb Jahre nach Projektbeginn erfolgen und ist Voraussetzung für den Erhalt des Labels.
Viele der im Projekt zu erbringenden Leistungen lassen sich mit bereits geplanten Aktivitäten der Stadt Wernigerode verknüpfen. Die im Rahmen des Projekts angebotene externe Begleitung und der intensive Erfahrungsaustausch mit neun weiteren Pilotkommunen wird die Einführung und Umsetzung neuer, naturnaher und kostengünstiger Bewirtschaftungsmethoden für das öffentliche Grün erleichtern. Aufgrund der begleitenden Kampagne sowie dem Erhalt des Labels kann sich die Stadt Wernigerode bundesweit als Vorbild präsentieren und ihr ökologisches Profil schärfen.
Wie profitiert die Stadt von der Teilnahme als Pilotkommune?
- Finanzielle Förderung von bis zu 62.100 Euro
- Inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung von naturnahen und kostensparenden Pflegekonzepten im Bereich des öffentlichen Grüns
- Unterstützung bei der lokalen Öffentlichkeitsarbeit durch Vorlagen (Flyer, Plakate etc.) und Hinweise zur Durchführung eigener Maßnahmen
- Vernetzung und Austausch mit neun weiteren Pilotkommunen sowie mit wissenschaftlichen Experten im Rahmen der projektbegleitenden Arbeitsgruppe
- Bundesweite Aufmerksamkeit und Möglichkeit sich als im Naturschutz engagierte Kommune zu profilieren
Hintergrund
Die Bedeutung öffentlicher Grünflächen für Wirtschaft, Natur und Lebensqualität
Parks, Biotope, Stadtwälder oder Brachflächen bieten durch eine extensive und sich dynamisch verändernde Nutzung Chancen für großen Artenreichtum. Zahlreiche Studien zeigen, dass Städte im Vergleich zu der sie umgebenden Landschaft zum Teil bereits wesentlich artenreicher sind. Viele heimische Arten, wie Mauersegler, Fledermäuse oder Igel, finden auf urbanen Freiflächen einen Lebensraum, aber auch gebietsfremde Arten siedeln sich aufgrund für sie vorteilhafter Standortbedingungen, wie Wärme oder Trockenheit, an. Dabei gilt: Je besser eine Stadt durchgrünt ist, desto höher ist auch der Anteil einheimischer Arten und Arten mit besonderen Habitatansprüchen. Aber nicht nur Tiere und Pflanzen profitieren von urbanen Grünflächen. Auch für uns Menschen erbringt die Natur wichtige Dienstleistungen. Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich tragen unter anderem zum stadtklimatischen Ausgleich (Frischluft/Kühlung) und zur Filterung von Luftschadstoffen bei, sichern Wasser- und Stoffkreisläufe und spielen eine bedeutende Rolle für Erholung und Naturerfahrung im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen. Sie bilden damit eine „grüne Infrastruktur“, die wesentlich zur wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Entwicklung einer Kommune beiträgt und erhöhen die Lebensqualität für die in Städten lebenden Menschen.
Im Zusammenhang mit dem Schlagwort „Lebensqualität“ kommt den innerstädtischen Grünflächen eine enorme Bedeutung als Standortfaktor im Wettbewerb um hochqualifizierte Arbeitskräfte und Unternehmen zu. Gerade für Familien spielt die Erreichbarkeit von Grünflächen sowie ein von Umweltbeeinträchtigungen freies Wohnumfeld eine bedeutende Rolle. Städtische Naturräume gehören dementsprechend immer häufiger zu den „Attraktionen“, mit denen im Standortmarketing einer Kommune geworben wird. Diese Qualität von Grünflächen drückt sich auch in den Preisen für Grundstücke und Immobilien aus. Eine Untersuchung für 16 deutsche Mittel- und Großstädte hat ergeben, dass neben nicht freiraumbezogenen Faktoren wie zum Beispiel Stadtgröße und Gebietstyp insbesondere Grünanlagen im direkten Wohnumfeld den Bodenrichtwert erheblich erhöhen. Eine komplexe Vegetation und hohe Strukturvielfalt gehören dabei zu den dominierenden Kriterien einer positiven Wahrnehmung städtischer Natur: Schweizer Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass naturnahe Flächen gegenüber monotoner und artenarmer Natur bevorzugt werden.
Ziele des Projekts
Damit öffentliche Grünflächen dazu in der Lage sind, die genannten ökologischen und sozialen Wohlfahrtswirkungen zu entfalten, müssen deren Planung und Bewirtschaftung in ökologischer Hinsicht optimiert werden. Das Projekt „Stadtgrün – Artenreich und Vielfältig“ zielt darauf ab, in möglichst vielen Kommunen ein ökologisches Grünflächenmanagement zu etablieren und Akzeptanz für die damit zusammenhängende naturnahe Gestaltung öffentlicher Grünflächen zu schaffen. Mit dem Begriff Grünflächen sind dabei alle überwiegend unbebaute, teilweise grüne, begrünte oder unbefestigte Flächen gemeint, unabhängig von Typ, Struktur oder Nutzungsart. Damit können Brachflächen ebenso berücksichtigt werden wie beispielweise urbane Wälder, Gewässerrandstreifen, Parkanlagen oder Straßenbegleitgrün. Im Rahmen dieses Projektes werden zudem ausschließlich Grünflächen berücksichtigt, die sich im Besitz oder in der Verantwortung der Kommune und die sich zudem innerhalb des Siedlungsbereichs befinden. Eine differenzierte und naturnahe Gestaltung dieser Flächen kann langfristig nicht nur zur Erhöhung der Artvielfalt im urbanen Raum beitragen, sondern ist laut Studien des Züricher Instituts für Umwelt und Natürliche Ressourcen auch mit einer deutlichen Kosteneinsparung verbunden: Extensive Pflanzensysteme ergeben demnach bei fachlicher und termingerechter Pflege einen Pflegeaufwand von durchschnittlich zehn Minuten pro Jahr und Quadratmeter. Klassische Staudenpflanzungen und Wechselflorrabatten beanspruchen dagegen mindestens den dreifachen Aufwand.
Zentrales Anliegen des Labeling-Verfahrens ist die ökologische Aufwertung von Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich. Dementsprechend werden Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung von Grün- und Freiflächen bewertet. Die Stadt Wernigerode muss hierzu die Planung und Durchführung entsprechender Maßnahmen belegen und im Rahmen eines Monitorings dokumentieren. In diesem Sinne stellt das Label eine hervorragende Gelegenheit zur Darstellung der kommunalen Naturschutzaktivitäten und Planungen dar und kann im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit und Imagewerbung genutzt werden. Die Planung und Umsetzung von Strategie und Maßnahmenplan sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit werden zudem durch Hilfestellungen in Form von Handreichungen und Ansprechpartnern beim Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ unterstützt. Auch der im Rahmen des Projekts organisierte Austausch mit neun weiteren Pilotkommunen wird dazu beitragen, den Arbeitsaufwand bei der Einführung eines ökologischen Grünflächenmanagements zu minimieren.
Für den Erhalt des Labels muss die Stadt Wernigerode einen mehrstufigen Prozess durchlaufen, an dem auch Akteure außerhalb der Kommunalverwaltung beteiligt werden. Damit wird das Thema aus der Kommunalverwaltung in die Bürgerschaft getragen. Dies kann zur Entlastung der Stadt beitragen, die Akzeptanz gegenüber naturnah gestalteten Flächen innerhalb der Bevölkerung erhöhen und durch die Möglichkeit zur Mitgestaltung des unmittelbaren Lebensumfelds einen wichtigen Beitrag zu Naturerfahrung und Identifikation mit der eigenen Kommune leisten. Die Vergabe des Labels ist zudem mit der Berücksichtigung ökologischer Grundsätze im Rahmen der zu erarbeitenden Grünflächenstrategie verbunden, deren Umsetzung durch einen politischen Beschluss garantiert werden soll. Das Label in den Stufen Bronze, Silber und Gold wird jeweils für drei Jahre verliehen.
Begleitende Maßnahmen zur Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
Die naturnahe Gestaltung öffentlicher Grün- und Freiflächen betreffend, existieren oftmals noch große Vorbehalte. Naturnahe Flächen werden häufig als „wild“, „ungepflegt“ und somit „störend“ empfundenen. Hier gilt es, mit klugen Argumenten und einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit auf einen Bewusstseinswandel in Bezug auf das Erscheinungsbild und die Bedeutung öffentlicher Grünflächen hinzuwirken. Unterstütz wird diese auf Akzeptanz und Bewusstseinsbildung abzielende Wirkung durch eine bundesweite Kampagne, welche den Wert naturnaher Grünflächen in den Fokus rückt.
Im Rahmen der Kampagne wird die Stadt Wernigerode dabei unterstützt, ihre Aktivitäten vor Ort zu präsentieren und die lokale Bevölkerung für die Bedeutung der öffentlichen Grünflächen zu sensibilisieren. Hierzu werden vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ digitale Vorlagen erstellt (Flyer, Roll-Ups, Plakate etc.), die durch lokalspezifische Inhalte ergänzt werden können. Außerdem werden im Rahmen eines Handlungsleitfadens wichtige Anhaltspunkte für eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit zum Thema naturnahe Grünflächen geboten. Dieser Handlungsleitfaden wird auch Vorschläge für Aktionen, Veranstaltungen und Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürger enthalten, um neben klassischer PR auch über das Erleben und Mitgestalten Akzeptanz zu erzeugen. Höhepunkt der Aktivitäten vor Ort wird ein Aktionstag sein, bei dem die bislang umgesetzten und geplanten Maßnahmen der Stadt Wernigerode den Bürgern vorgestellt und Möglichkeiten zur Beteiligung bei der naturnahen Gestaltung öffentlicher Grünflächen aufgezeigt werden. Auf Bundesebene wird das Bündnis das lokale Engagement sichtbar machen. Hierzu wird durch Pressemitteilungen, Fachkongresse und Beiträge in den bündniseigenen Medien (Newsletter und Homepage) auf das Projekt im Allgemeinen sowie ganz konkret auf unterschiedliche Aktivitäten vor Ort hingewiesen. Im Rahmen eines eigenen Bereichs auf den Internetseiten des Bündnisses werden zudem die Strategien und umgesetzten Projekte der am Labeling-Verfahren teilnehmenden Kommunen dokumentiert. Nach und nach wird so eine umfassende Beispielsammlung entstehen, welche konkrete Hinweise und Praxisbeispiele zur strategischen Umsetzung eines ökologischen Grünflächenmanagements bietet und somit auch andere Kommunen zum Handeln motivieren kann.
Um die Praxistauglichkeit des Labels sowie der Kampagne sicher zu stellen, werden die zehn Pilotkommunen in deren Entwicklung einbezogen. Label und Kampagne werden anschließend in den Pilotkommunen erprobt und entsprechend weiterentwickelt. Die zehn Pilotkommunen erhalten im Gegenzug eine finanzielle Förderung für die im Zusammenhang mit dem Label stehenden Maßnahmen.
Welche Förderung erhält die Stadt für ihre Teilnahme als Pilotkommune?
Die Stadt Wernigerode kann in diesem Zusammenhang für folgende Aufgaben eine 100-prozentige Förderung erhalten:
- Bestandsaufnahme – bis zu 10.000 €: Erfassung der Ausgangsituation in den Pilotkommunen. Die Fördermittel können bspw. zur Erarbeitung eines Grünflächenkatasters oder zur Kartierung einzelner Flächen durch externes Fachpersonal verwendet werden.
- Konzeptionierung – bis zu 10.000 €: Erarbeitung einer Grünflächenstrategie mit Maßnahmenplan. Die Fördermittel können dazu eingesetzt werden, externes Fachpersonal in die Erarbeitung mit einzubeziehen.
- Kartierung – bis zu 9.000 €: Kartierung der in Zusammenhang mit der Grünflächenstrategie stehenden Flächen sowie der geförderten Maßnahmen in den Pilotkommunen, um erste naturschutzfachliche Ergebnisse zu erfassen. Zielsetzung ist die Dokumentation ökologischer Verbesserungen durch die Umsetzung der Grünflächenstrategie.
Die im Rahmen des Projekts umzusetzende Maßnahme im Bereich öffentlicher Grünflächen wird mit bis zu 31.200 € und zu 52 Prozent gefördert. Die Maßnahme muss im Zusammenhang mit der zu erarbeitenden Grünflächenstrategie stehen und durch ein hohes Maß an Übertragbarkeit auf andere Kommunen/Kontexte gekennzeichnet sein. Die Fördermittel können für Materialkosten oder die Beauftragung externen Fachpersonals eingesetzt werden.
Gaffert
Oberbürgermeister